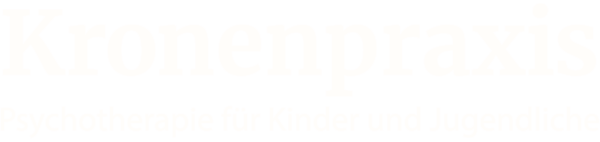Die psychoanalytische Haltung…
sieht im Patienten nicht das „Objekt“ einer „Behandlung“, sondern respektiert und begleitet ihn als ein zunehmend selbstbestimmtes Subjekt seiner Heilung. Im therapeutischen Prozess wird der jeweils besondere Sinnzusammenhang zwischen der Symptomatik des Patienten und dem dahinter liegenden, ursächlichen, meist unbewussten inneren Konfliktgeschehen vor dem Hintergrund seiner individuellen Lebensgeschichte nach und nach erfasst.